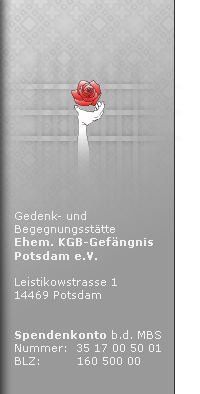PM zur Buchpremiere "Verschleppt, verbannt, verschwunden" am 7. November
Neuerscheinung
„Verschleppt, verbannt, verschwunden: Deutsche Kriegsjugend in Stalins Lagern und
Gefängnissen“ von Grit Poppe und Niklas Poppe
Das Sachbuch ist im Mitteldeutschen Verlag (400 Seiten, ISBN: 978-3963119156, 28,- €)
erschienen und seit dem 17. September 2024 im Buchhandel erhältlich.
Der Verein Gedenk-und Begegnungsstätte eh. KGB-Gefängnis Potsdam möchte auf das eben
erschienene Sachbuch „Verschleppt, verbannt, verschwunden: Deutsche Kriegsjugend in Stalins
Lagern und Gefängnisses“ aufmerksam machen.
In dem Buch erzählen die Autoren Grit und Niklas Poppe die Schicksale Jugendlicher und junger
Erwachsener nach, die in dem ehemaligen Gefängnis in der Potsdamer Leistikowstraße, der
Untersuchungshaftanstalt der sowjetischen Geheimpolizei, unter unmenschlichen Bedingungen
eingesperrt waren. Es sind emotionale Porträts der Betroffenen und sie geben Einblicke in die
Vielfalt der Schicksale – unter ihnen auch Schüler aus Potsdam. Alle waren nach der NS-Zeit, nach
Kriegs- und Nachkriegserlebnissen in die Fänge des sowjetischen Geheimdienstes geraten,
verhaftet und verschleppt – oft ohne dass ihre Angehörigen etwas von ihrem Schicksal erfuhren.
Grit und Niklas Poppe schildern die Leidensgeschichten und Hafterfahrungen der Jugendlichen
aus der SBZ und DDR, die jung und unschuldig, oft für Jahre in einem der Gefängnisse oder
Speziallager der Sowjets und im Gulag verbrachten und ihre Jugend dabei verloren haben. Nicht
wenige mussten ihr Leben lassen. Im Mittelpunkt des Buches stehen die Betroffenen selbst. Ihre
Erinnerungen werden so wiedergegeben, dass sie für die Leser und Leserinnen emotional
nachvollziehbar sind und deutlich wird, wie schwer und nachhaltig Menschenwürde und
Menschenrechte verletzt wurden. Menschen einer schwindenden Generation kommen zu Wort.
Der Gedenkstätten-Verein hat das Buch angeregt und unterstützt und die Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur mit Mitteln gefördert. Im Deutschlandfunk ist ein Beitrag zum Buch
https://www.mitteldeutscherverlag.de/geschichte/kulturgeschichte/poppe,g-poppe,-n
poppe-poppe-verschleppt,-verbannt,-verschwunden-detail gebracht worden.
Über die Autoren:
Grit Poppe, geb. 1964, studierte am Literaturinstitut in Leipzig und arbeitet als freiberufliche
Autorin. Sie schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Jugendromane
„Weggesperrt“ und „Verraten“ wurden mehrfach ausgezeichnet. Mit Niklas Poppe veröffentlichte
sie 2021 „Die Weggesperrten. Umerziehung in der DDR – Schicksale von Kindern und
Jugendlichen“.
Niklas Poppe, geb. 1991, studierte an der Martin-Luther-Universität Halle (Saale) Deutsche
Sprache und Literatur sowie Geschichtswissenschaft und war dort später Lehrbeauftragter. Er
arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter in der Gedenkstätte ROTER OCHSE in Halle (Saale).
Für weitere Informationen oder Interviews stehen die Autoren gern zur Verfügung.
Kontakt über Grit Poppe: GritPoppe@aol.com
Wo Putin sein Handwerk lernte: Die Saat des KGB vergiftet Russland seit 70 Jahren
Am 13. März 1954 wurde einer der gefürchtetsten Geheimdienste der Welt gegründet: das Komitee für Staatssicherheit. Trotz seiner offiziellen Auflösung 1991 ist das Erbe des KGB immer noch spürbar.
Lukas Ossenkopp in Uckermarkkurier am 13.03.2024
MoskauDas Komitee für Staatssicherheit galt als einer der gefürchtetsten Geheimdienste der Welt. Heute vor 70 Jahren, am 13. März 1954, nahm der KGB seine Arbeit auf. Seine Angestellten unterstanden direkt der Staatsregierung, dem Ministerrat der UdSSR. Somit mussten sie keine Rechenschaft vor anderen Ministerien ablegen. Die absolut linientreuen Funktionäre des KGB verstanden sich als „Schild und Schwert“ der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU).
Ihre Aktionen koordinierte die Behörde von ihrer Moskauer Zentrale aus, der Lubjanka. Unter dem Dach des enormen Baus im neobarocken Stil vom Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen holzvertäfelten Arbeitszimmern waren sämtliche 14 Hauptverwaltungen des Geheimdienstes zusammengefasst. Die „Auslandsaufklärung“, die Informationen über den „Klassenfeind“ sammelte und die Durchführung von Spezialoperationen überwachte, sowie die „Spionageabwehr“, die für den Schutz vor ausländischen Schlapphüten zuständig war, hatten unter den Abteilungen einen erhöhten Stellenwert.
Zur Sicherung der Position der KPdSU war die „politische Polizei“ mit der Unterdrückung und Verfolgung von tatsächlichen und vermeintlichen Gegnern des Regimes betraut. In den düsteren Kellern des Dienstsitzes war sogar ein Gefängnis des KGB. Dort wurden politische Dissidenten von Agenten ohne Skrupel in die Mangel genommen und zu Pseudo-Geständnissen genötigt.
Die restlichen Verwaltungen der Behörde waren unter anderem für die Überwachung des Militärs, den Schutz vor Industriespionage, das Abhören des Fernmeldewesens und den Personenschutz von hochrangigen Parteifunktionären zuständig. Diese Aufgabenfülle machte den KGB neben dem Militär zu einer der einflussreichsten Institutionen im Machtapparat der Sowjetunion.
Nach dem Vorbild der Geheimpolizei Tscheka
Das solide Fundament für diese unangefochtene Stellung legten bereits die Bolschewisten im Dezember 1917. Nach ihrem Putsch versuchten sie unter der Führung von Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) alles, um in den Wirren des russischen Bürgerkriegs an der Macht zu bleiben. So gründete Feliks Dzier?y?ski (1877-1926), dessen Statue noch lange vor der Zentrale des KGB stand, die Geheimpolizei Tscheka. Zur Stabilisierung des kommunistischen Regimes schreckte sie auch vor zehntausendfachen politischen Morden nicht zurück.
In den folgenden Jahren wurde die Organisation mehrmals umbenannt und umstrukturiert, doch ihr Ziel blieb unverändert: die Absicherung der Einparteienherrschaft der KPdSU. Die Traditionslinie verdichtete sich sogar im Sprachgebrauch, so wurden die Mitglieder des KGB im Volksmund als „Tschekisten“ bezeichnet.
Auch nach der Terrorherrschaft von Josef Stalin standen in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre Verhaftungen von Andersdenkenden und politischen Gegnern in der Sowjetunion auf der Tagesordnung. Unter dem Vorwurf von „antisowjetischer Agitation und Propaganda” wurden zahlreiche Regimegegner aus dem Verkehr gezogen und interniert.
Beeinflussung der „Objekte“ durch informellen Druck
Da trotz des harten Vorgehens Aufstände gegen die Partei nicht gänzlich zu verhindern waren, wie im Jahr 1962 in der Fabrik für Elektrolokomotiven in Nowotscherkassk, änderte der KGB seine Vorgehensweise. Nun sollte die Beeinflussung der Bürger und Bürgerinnen, die im Geheimdienstjargon nur als „Objekte“ bezeichnet wurden, durch informellen Druck geschehen. Dabei erhofften sich die Agenten, jegliches Aufbegehren gegen das System bereits im Keim zu ersticken.
Obwohl der KGB die eigene Bevölkerung unterdrückte, genoss die Organisation hohes Ansehen. Eine Ausbildung beim Geheimdienst war für viele junge regimetreue Sowjetbürger sehr verlockend, denn neben einer üppigen Entlohnung eröffnete sie Wege in die höheren Kreise des Parteiapparats.
Auch im Ausland agierten die Agenten mit äußerster Härte. Giftattentate, Mordanschläge und Entführungen gehörten zum Repertoire der Spione. 1964 wurde ein unabhängiger Gutachter vergiftet, als er die Botschaft der Bundesrepublik in Moskau auf Abhörwanzen untersuchen sollte. Ende der 1970er-Jahre töteten Spezialkräfte des KGB den afghanischen Präsidenten Hafizullah Amin in seinem Palast in Kabul.
Ebenfalls hatte der KGB stets ein wachsames Auge auf die „sowjetischen Bruderstaaten“. Obwohl ihnen offiziell die geheimdienstliche Unabhängigkeit zugesichert war, überwachten beispielsweise die russischen Agenten die Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR. Besonders über die Westpolitik der SED-Führung wollte der „große Bruder“ stets aus seinen eigenen Quellen informiert werden.
Archive der Lubjanka weiterhin fest verschlossen
Erst kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion bröckelte die Machtbasis des KGB und die Organisation wurde im Dezember 1991 offiziell aufgelöst. Doch alte gewiefte Kader schafften es, sich auch in der Russischen Föderation zu etablieren. Schließlich war auch das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt Boris Jelzin auf einen funktionierenden Geheimdienst angewiesen. So konnten im neuen Inlandsgeheimdienst „Föderaler Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation“ (FSB), dem Auslandsgeheimdienst SWR und dem Militärgeheimdienst GRU (heute GU) zahlreiche Funktionäre unbehelligt weiter operieren.
Auch nach der formellen Umstrukturierung blieb die Aufarbeitung der unzähligen verbrecherischen Maßnahmen des KGB im Dunkeln, obwohl die Gesellschaft ein erhebliches Interesse daran hätte. Auf ihrem personellen Zenit arbeiteten immerhin rund 480.000 Agenten für den sowjetischen Geheimdienst. Viele Familien in Russland könnten Opfer- oder Tätergeschichten erzählen.
Doch bleiben die Archive der Lubjanka fest verschlossen, auch ehemals Betroffenen wird keine Einsicht in die Akten gewährt. Kaum verwunderlich, denn an der Spitze des Staates steht ein Mann, der früher selbst für den KGB gearbeitet hat. Wladimir Putin war einst als Agent in Dresden stationiert und leitete später den Inlandsgeheimdienst FSB. Nach seinem Aufstieg zum Präsidenten 1999 hatte er seine ehemaligen Weggefährten nicht vergessen. So hievte der Machthaber einige seiner engsten Begleiter in Schlüsselpositionen von Militär, Regierung und wichtigen Behörden.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich der Einfluss der Geheimdienste nochmals erhöht, dabei greifen die Mitarbeiter auf bewährte Methoden aus der Sowjetzeit zurück. Dr. Manfred Sapper, Politikwissenschaftler und Chefradakteur der Zeitschrift „Osteuropa“, resümiert: „Mit dem geheimdienstlichen Mittel der Desinformation werden kritische Wissenschaftler eingeschüchtert, Oppositionspolitiker werden mit dem Stempel ,Volksgegner‘ oder ,Landesverräter‘ diskreditiert und unabhängige Medien oder NGOs als ,ausländische Agenten‘ gebrandmarkt.”
Nachruf für Gisela Kurze

Gisela Kurze war 1997 seit der „ersten Stunde“ der Öffnung des ehemaligen KGB-Gefängnisses für die Öffentlichkeit dabei. Als Historikerin für die deutsche Abteilung von Memorial St. Petersburg e.V. wirkte sie an der Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“ entscheidend mit, kümmerte sich liebevoll um die Zeitzeugen, die in den Folgejahren ankamen und sich als Gefangene des Potsdamer KGB nach dem 2. Weltkrieg zu erkennen gaben. Für einige von ihnen gab sie deren biografischen Berichte als Broschüren heraus, übernahm viele Dienste des Arbeitskreises und späteren Vereins, der sich an den Wochenenden um die Besucher der Gedenkstätte bemühte und gewährleistete, dass das Haus nicht mehr abgerissen werden konnte. 1999 bis 2001 half sie der Potsdamer Gruppe von Amnesty International, Schulklassen zu betreuen, die einmal monatlich in das Thalia-Kino zu Filmen über Menschenrechte gezeigt wurden. In dem langen Prozess, der das Gefängnis des ehem. russischen Geheimdienstes zur Anerkennung als eine der Gedenkstätten des Landes Brandenburg werden ließ, wirkte die spätere Vorsitzende von Memorial Deutschland e.V. mit ihrer guten historischen Kenntnis und der russischen Sprache in unaufgeregter aber deutlicher und diplomatischen Weise mit. Vielen Zeitzeugen war sie ein Sprachrohr, die ihr zahlreiche öffentliche Zeitzeugengespräche verdankten. Die letzten 7 Jahre lebte sie zurückgezogen, ihre menschlische Wärme fehlte uns in Potsdam. Jetzt nach ihrem Tod am 2. Dezember 2023 bleibt uns große Dankbarkeit für alles, was sie für uns war.
Christian Albroscheit
Zum Tod von Gisela Kurze: Den Überlebenden zugewandt
Von Kay Grimmer, PNN und Tagesspiegel am 9.1.24
Gisela Kurze sorgte maßgeblich für den Aufbau der Potsdamer Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße. Im Dezember ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.
Als Gisela Kurze das Haus in der Leistikowstraße sah, in dem über Jahrzehnte das Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes KGB untergebracht gewesen war, schien sie zu ahnen, dass es zu ihrem späten Lebensprojekt werden würde. Gisela Kurze hatte ein Herz, das immer groß genug war, sich den Überlebenden dieses unmenschlichen Ortes zuzuwenden und die Schicksale der vielen unschuldig Inhaftierten lebendig zu halten.
Das Gründungsmitglied der Potsdamer „Arbeitsgemeinschaft Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Leistikowstraße“ und Vorstandsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial Deutschland verstarb bereits am 2. Dezember des vergangenen Jahres, wie der Verein der Gedenkstätte am Montag mitteilte.
Kurze brachte Opferbiografien heraus
Kurze gehörte zu den Menschen, die das ehemalige Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Besatzungsmacht in den 1990er-Jahren in Augenschein nehmen konnten, weit vor der offiziellen Öffnung als Gedenk- und Begegnungsstätte im Jahr 2008. So berichten die Vereinsmitglieder Gisela Rüdiger und Bettina Paulsen. Gisela Kurze ließ der Ort nicht mehr los. Die Biografien der unschuldig Inhaftierten interessierten sie.
„Sie wollte aufklären und an diese Menschen erinnern“, schreibt der Verein in seinem Nachruf auf Gisela Kurze und ihr bürgerschaftliches Engagement. So hat Kurze Opferbiografien herausgegeben, viele Zeitzeugengespräche geführt, um die Geschichte wach und lebendig zu halten. „Ihre Zuwendung zu den Überlebenden war einmalig“, heißt es in der Reaktion des Vereins auf den Tod der 87-jährigen gebürtigen Berlinerin.
2007 erhielt sie den Verdienstorden des Landes Brandenburg
Ihr Engagement blieb nicht unbemerkt. So erhielt Gisela Krause im Jahr 2007 aus den Händen des damaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) den Verdienstorden des Landes Brandenburg.
Ihr wirkliches Vermächtnis ist das Haus in der Leistikowstraße 1, das zu einer Gedenk- und Begegnungsstätte umgebaut wurde. „Wir verdanken ihr wesentlich den Erhalt des Gebäudes als Erinnerungsort für die Opfer des Stalinismus“, heißt es im berührenden Nachruf des Vereins „Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam“.
Potsdamer Gedenkstätte trauert um Gisela Kurze
Nachruf für engagierte Historikerin
Volker Oelschläger, MAZ am 10.01.24
Die Zuwendung der Historikerin Gisela Kurze zu den Überlebenden des ehemaligen KGB-Gefängnisses in der Potsdamer Leistikowstraße war einmalig. Das schreiben ihre Mitstreiter in einem Nachruf.
Nauener Vorstadt. Über Jahrzehnte hat sich die Berliner Historikerin Gisela Kurze für die Erhaltung der Spuren des ehemaligen KGB-Gefängnisses in der Leistikowstraße für die Nachwelt eingesetzt: „Als originäres Relikt totalitärer Herrschaft ist es deutschlandweit einmalig“, sagte sie. Ihr Credo: „Dieses Haus muss in seinem Ist-Zustand konserviert werden.“ Seit 1995 engagierte sie sich im Verein Arbeitsgemeinschaft Gedenk- und Begegnungsstätte Ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam.
Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen sorgte sie dafür, dass der einstige Schreckensort für Publikum geöffnet wurde, organisierte Führungen, sammelte Spenden, recherchierte die Geschichte des Tatortes und die Biographien von einst Inhaftierten.
Über Potsdam nach Workuta
„Sie wollte aufklären und an diese Menschen erinnern“, schreibt der Verein in einem Nachruf für die Historikerin: „Deutsche Jugendliche, die Widerstand leisteten gegen die Sowjetisierung der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR, Angehörige der sowjetischen Besatzungstruppen, die ihre brutale Behandlung nicht aushielten, oder Menschen, die für westliche Geheimdienste arbeiteten, um für eine Demokratisierung der DDR zu kämpfen.“
Gisela Kurze wirkte maßgeblich mit an der ersten Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“, die an die Rolle des einstigen Pfarrhauses als Durchgangsstation zu Stalins Gulag-System plastisch werden ließ. Sie kämpfte erfolgreich dafür, dass das ehemalige Gefängnis Gedenkstättenstatus und Förderung bekam.
2007 ist sie für ihr Wirken mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. Erst jetzt ist bekannt geworden, dass Gisela Kurze am 2. Dezember 2023 im Alter von 87 Jahren verstorben ist: „Unser Verein denkt in Dankbarkeit an sie zurück“, heißt es im Nachruf: „Ihre Zuwendung zu den Überlebenden war einmalig.“
________________________________________________________________________________________________
Historiker Karl Schlögel kritisiert eine Entscheidung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, MAZ im August 2023
15. oder 23. August? Es scheint nur um ein Datum zu gehen. Der Streit zwischen dem Gedenkstättenverein KGB-Gefängnis und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mutet etwas grotesk an. Doch der Historiker Karl Schlögel erklärt in einem Gastbeitrag, warum er den 23. August für sehr viel zwingender hält.
Potsdam. Das ehemalige KGB-Gefängnis in der Leistikowstraße in Potsdam gehört zu den eindringlichsten Museen und Gedenkstätten im Raum Berlin-Brandenburg. Besucher, die vom Zauber des preußischen Arkadien hingerissen, sich am Heiligen See, im Neuen Garten und Schloss Cecilienhof ergehen, lernen hier in nächster Umgebung, in dem ehemaligen Haus der Evangelischen Frauenhilfe eine andere, die dunkle Seite Potsdams kennen. Auf einem historischen Pfad kann man hier das Terrain des ehemaligen sowjetischen „Militärstädtchens Nr. 7“ abschreiten mit der heutigen Gedenk- und Begegnungsstätte im Zentrum.
Besuchern, die durch die sorgfältig konservierten Flure, Räume, Zellen des ehemaligen Gefängnisses der sowjetischen Militärspionageabwehr wandern, sind hier konfrontiert mit Zeugnissen und exemplarischen Lebensschicksalen der Opfer, die hier verhört, gefoltert, in Lager verschickt oder – wie in fast Hundert dokumentierten Fällen – auch hingerichtet worden sind. Dass es zur Rettung dieses Ortes nach Auflösung des KGB 1991 und dem Abzug der sowjetischen Truppen 1994 und seiner Umwandlung in eine Stiftung Gedenk- und Begegnungsstätte im Jahre 2008 gekommen ist, ist ohne den Einsatz des Vereins aus Potsdamer und Berliner Bürgerrechtlern, ehemals Inhaftierten und deren Angehörigen nicht denkbar.
Die Stiftung hat dem Verein untersagt, eine Gedenkveranstaltung am 23. August abzuhalten
Umso schmerzlicher muss jeden, der die Gedenkstätte und ihre Aktivitäten in den letzten Jahren verfolgt hat, die Nachricht treffen, dass die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten dem Verein untersagt hat, in diesem Jahr – wie schon in den Jahren zuvor – eine Gedenkveranstaltung am 23. August im Vortragsraum des Gebäudes in der Leistikowstraße abzuhalten; statt dessen soll der Verein an der von der Stiftung für den 15. August festgesetzten Veranstaltung teilnehmen. Der Streit um das Datum – 15. oder 23. August – scheint bizarr, aber offensichtlich geht es hier mehr als um einen Termin-Konflikt.
Der Verein, der über Jahre hinweg treibende Kraft für die Errichtung der Gedenkstätte war, möchte wie bisher am 23. August zusammenkommen. Das Datum wurde vom Europa-Parlament 2009 zum „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer totalitärer und autoritärer Regime“ bestimmt. Am 23. August 1939 kam es zum Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes, mit dem im Geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung Europas zwischen Hitlers und Stalins Reich beschlossen wurde. Damit war der Beginn des Zweiten Weltkriegs, Deutschlands Überfall auf Polen am 1. September und Stalins Einmarsch in Ostpolen am 17. September besiegelt.
Die Stiftung hingegen hat sich für den 15. August entschieden, weil am 15. August 1945 das Gebäude des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins durch die sowjetische Besatzungsmacht übernommen wurde. Man kann das Insistieren auf der Authentizität von Ort und Zeit gut verstehen in einer Zeit, da lieux de memoire oft nach Belieben konstruiert oder gar erfunden werden. Allerdings muss man der Argumentation, die nun schon Monate lang zwischen der Stiftung und dem Verein hin und her geht, an einigen Punkten entschieden widersprechen. So heißt es etwa in der Darlegung des Direktors der Stiftung, Axel Drecoll, dass man den 23. 8. ablehne, weil er mit dem Ort in der Leistikowstraße nichts zu tun habe und missverstanden werden könne.
Unser Gastautor Karl Schlögel bei einer Lesung aus seinem Buch „Das russische Berlin“ (2019).
Zu unserem Gastautor Karl Schlögel:
Karl Schlögel ist Deutschlands gefragtester Osteuropa-Historiker. Von 1994 bis zu seiner Emeritierung war er Professor für Osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
Regelmäßig veröffentlicht Schlögel viel beachtete Bücher wie „Das sowjetische Jahrhundert“ (2017) oder „Die Mitte liegt ostwärts“ (2002). Zuletzt erschien von ihm: „Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen“ (2015/?erweiterte Neuausgabe 2022).
______________________________________________________________________________
Zum 80. Jahrestag des Molotow-Ribbentrop-Vertrags hielt Karl Schlögel am 23. August 2019 auf Einladung des Vereins in der Leistikowstraße einen Vortrag zum Thema „1939 – Über den Zusammenhang von Appeasement und Entfesselung des Zweiten Weltkriegs“.
Als Vaclav Havel, Joachim Gauck und andere, meist aus Ostmitteleuropa kommende Intellektuelle und Politiker im Jahre 2008 in Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt in ihrer Prager Erklärung dazu aufriefen, das Datum des Paktes in eine weiter gefasste europäische Erinnerungs- und Gedenkkultur aufzunehmen, ging es ihnen um die Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen und stalinistischen Systems. Als das Europäische Parlament im Jahre 2009 mit großer Mehrheit seine Resolution „Erinnerung an die Opfer aller totalitären und autoritären Regimes“ verabschiedete, sollte endlich eines Tages gedacht werden, der bis dahin – und bis heute – fast nur im kollektiven Gedächtnis der Ostmitteleuropäer präsent ist. Die Menschenkette des „Baltischen Weges“ zwischen Tallinn, Riga und Vilnius am 23. August 1989 gehört zu den Ereignissen, die, wie wir heute wissen, den Fall der Mauer vorbereiteten und die Rückkehr der sowjetisch besetzten baltischen Republiken in ihre Unabhängigkeit und Freiheit einleiteten.
Die Erfahrungen der Ostmitteleuropäer werden in Deutschland gern als russophob abqualifiziert
Man hat sich im Westen, besonders in Deutschland immer schwergetan, die Erfahrung der Ostmitteleuropäer zur Kenntnis und ernst zu nehmen, bis heute neigt man dazu, wie die Reaktionen von öffentlicher Meinung und Politik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zeigen, sie als russophob oder hysterisch abzuqualifizieren. Man will nicht wahrhaben, dass auf die Befreiung Ostmitteleuropas von deutscher Wehrmacht und SS nicht die Entlassung in Unabhängigkeit und Freiheit folgte, sondern eine andere Diktatur, die bis zum Ende der Sowjetunion andauern sollte. Bis in die jüngste Zeit gab es im Bewusstsein der meisten Deutschen den 1. September 1939 – Beginn des Zweiten Weltkrieges – und den 22. Juni 1941 – den Überfall auf die Sowjetunion –, während die Zeit der Interaktion, ja Kollaboration der beiden Diktaturen und das Schicksal der unter doppelte Herrschaft geratenen Völker Osteuropas kaum zur Kenntnis genommen wurden.
Die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands nach 1945 teilte in diesem Sinne das Schicksal einer doppelten Diktaturerfahrung, von der der Westen – glücklicherweise – verschont blieb. In diesem Sinne gibt es einen Erfahrungs- und Erkenntnisvorsprung, den sie mit den Ostmitteleuropäern teilt. Die Topographie des Terrors im mittleren und östlichen Europa ist komplizierter als das west-fixierte Augen wahrzunehmen in der Lage oder willens sind. Der antitotalitäre Konsens, an den der 23. August erinnert, hat sehr wohl etwas mit dem Haus in der Leistikowstraße, dem Ort stalinistischer Herrschaft im Osten Deutschlands, zu tun.
Lore Siebert, Tochter der einst inhaftierten Marlis Steinert, in der Austellung „Im Spiegel der Erinnerung“ in der Gedenkstätte Leistikowstraße.
Dies zu zeigen, ist die große Leistung der Gedenkstätte, besonders auch seiner in den vergangenen Jahren gezeigten Ausstellungen, von denen viele nicht ohne die Mitwirkung von Memorial, der heute von Putin verfolgten und außer Landes getriebenen russischen Geschichts- und Menschenrechtsorganisation. Man kann sie auf der Homepage noch abrufen und lernt dabei, wie viele Wege aus der Leistikowstraße ostwärts, in Stalins Imperium führten – in die Butyrka, nach Workuta, Geschichten vom gestohlenen Leben unzähliger unschuldiger Opfer, darunter auch Sowjetbürger.
Die Wahrnehmung der Verbrechensgeschichte des Stalinismus schärft den Blick auf ein heilloses „Jahrhundert der Extreme“
Ein zweites Argument, von dem man dachte, es werde nicht mehr ernsthaft vorgebracht, nachdem nicht nur die Geschichte des Nationalsozialismus, sondern auch die des Stalinismus erforscht und bearbeitet wurde, lautet, die Erinnerung an die Interaktion und Kollaboration von NS und Stalinismus laufe auf eine „Relativierung“ des NS und des Holocaust, auf die Nivellierung der Unterschiede zwischen NS und Stalinismus hinaus und liefere der Rechten, was immer damit gemeint sein mag, Munition. In manchen, harmloseren Fällen zeugt dieses Argument von Ahnungslosigkeit, was den Stand europäischer Geschichtsarbeit angeht, zu der eben auch die Verbrechensgeschichte des Stalinismus gehört. Es hat nicht nur neue Quellen, sondern auch einen Perspektivwechsel gegeben, der die totalitäre Doppelerfahrung ins Zentrum rückt, die gerade nicht auf Entlastung und Relativierung von Gewalterfahrung hinausläuft, sondern Schärfung des Blicks auf das heillose „Jahrhundert der Extreme“.
Was es bedeutet, beide Totalitarismen ins Auge zu fassen, versteht, wer zwischen die Fronten geraten ist oder wer Wassili Grossmans „Leben und Schicksal“ gelesen hat. Im Grunde gilt gerade umgekehrt: Jemand, der sich in die Geschichte des nationalsozialistischen Terrors, des Völkermords, der Shoah hineingedacht und hineingearbeitet hat, der ist erst recht empfänglich für die Gewalterfahrung von Völkern und Gesellschaften, die den Stalinismus erlebt und überlebt haben.
Das Ringen um die angemessene Form des Gedenkens findet nicht in einem abstrakten Raum statt. In einem Augenblick, in dem keine zwei Stunden von Berlin Russland Krieg führt gegen die Ukraine, in dem bis noch vor Kurzem unvorstellbare Kriegsverbrechen begangen wurden, in dem in Putins Rhetorik völkischer Jargon der Nazis und stalinistischer Vernichtungsfuror ineinander übergehen, erscheint die Erfahrung, die in einer Einrichtung wie der in der Leistikowstraße aufbewahrt ist, zu kostbar, um im Streit um Termine und in Kämpfen um Definitionshoheit zerredet zu werden.
Es ist nicht gut, besonders in düsteren Zeiten, wenn in einer wichtigen Auseinandersetzung mit Raumverboten gearbeitet wird. Wie aus den Ankündigungen hervorgeht, gibt es nun zwei verschiedene Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Jeder kann sich entscheiden. Wenn man Walter Benjamins Formulierung „Geschichte schreiben heißt, Jahreszahlen ihre Physiognomie geben“ beherzigt, und wenn man den Gedenkort in der Leistikowstraße nicht bloß als ein Stück Lokalgeschichte ansieht, dann spricht einiges für den 23. August als Gedenktag. Aber jeder kann sich selber ein Bild machen.
_Spuren der Vergangenheit_, Wochenblatt "Die Kirche" zum 1.10.23
Einst Pfarrhaus, dann Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Spionageabwehr beherbergt die Gedenkstätte Leistikowstraße Potsdam heute ein zeitgeschichtliches Museum an historischem Ort
VON ULRIKE MATTERN.
Potsdam. Der Weg zur Gedenkstätte Leistikowstraße führt an einem spätsommerlichen Tag per Straßenbahn in ein Potsdamer Villenviertel. Zwischen Pfingstberg und Neuem Garten liegt das ehemalige zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Militärspionageabwehr. Von 1945 bis 1994 gehörte es zu dem von einer Mauer umgebenen, 16 Hektar großen Sperrgebiet in der Nauener Vorstadt mit Kontrollpunkten und Wachtürmen.
Besucher*innen können seit Mai mit ihrem Smartphone auf einem Audiowalk an 13 Stationen der Geschichte dieses Ortes folgen. Oder sie melden sich zu einer Führung an, die auf dem Innenhof der Gedenkund Begegnungsstätte beginnt. Ein Bronzemodell des sogenannten Militärstädtchens Nr. 7 vermittelt einen Überblick über das damalige Gelände. Im nahe gelegenen Schloss Cecilienhof fand ab dem 17. Juli 1945 die Potsdamer Konferenz statt. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion entschieden dort über die „4 Ds“: die Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung Deutschlands.
Im ehemaligen Untersuchungsgefängnis in der Leistikowstraße steht das Schicksal der Häftlinge ab 1945 im Fokus der Gedenkstätte. Die Frauen und Männer waren zwischen 14 und 80 Jahren alt. Sie alle wurden nicht rechtsstaatlich verurteilt. Es gab psychische und physische Gewalt; Geständnisse wurden erzwungen. Die Verurteilten kamen in ein Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion oder wurden mit dem Tode bestraft. Unter den Häftlingen befanden sich NS-Verbrecher, aber auch Jugendliche, die durch eine kritische Haltung zur Besatzungsmacht aufgefallen sein sollen. „Die Recherche ist Detektivarbeit“, sagt Josephine Eckert, die uns an diesem Samstagnachmittag durch das Haus führt. „Es gibt keinen Prototyp eines Häftlings.“ Von 1955 bis 1989 waren ausschließlich sowjetische Gefangene inhaftiert. Nach 1991 nutzte die russische Armee das Haus als Materiallager.
Das Treppengeländer in dem ehemaligen Pfarrhaus, der Schmuckbalken in der ersten Etage oder ein später zugemauerter schwarzer Kachelofen weisen auf den Alltag vor der Beschlagnahmung durch den sowjetischen Geheimdienst hin: Im Erdgeschoss war ab 1918 die Evangelische Frauenhilfe aktiv; im Obergeschoss lebte die Pfarrfamilie. Aus dem Kinderzimmer wurde nach 1945 ein Zimmer zur Vernehmung. „Wir finden unglaublich viele Spuren aus verschiedenen Zeiten“, sagt Eckert. So etwa Inschriften von Häftlingen im Keller mit seinen bedrückend engen Zellen, die von Leid und Einsamkeit zeugen.
Ein eingenähter Rosenkranz
Auf einem herzzerreißenden Foto in einer der Vitrinen sitzt Joachim Lange im September 1994, kurz nach der Rückgabe des Areals an die Stadt Potsdam, in einer dieser Kellerzellen auf einem Holzpodest. Lange war als 16-Jähriger wegen des Vorwurfs der Spionage 1947 fünf Monate lang an diesem Ort inhaftiert. Ein eingenähter Rosenkranz im Hosenbund eines 18-Jährigen, braune Strümpfe oder die Wolljacke einer Inhaftierten – viele persönliche Dinge erinnern an gewaltsam gebrochene Lebenswege. Selbst nach der Haftentlassung aus den sowjetischen Lagern im Jahr 1953 mussten die ehemaligen deutschen Inhaftierten in der DDR über ihr Los schweigen; viele von ihnen wussten damals gar nicht, dass sie in Potsdam inhaftiert waren. Die Dolmetscherin Marlise Steinert kehrte nach sechseinhalb Jahren an Silvester zurück. „Sie war so voll von Erinnerungen“, sagt ihre Tochter Lore Siebert an einer Hörstation. Steinert, die 1982 starb, schrieb in ihrer neuen Heimat im niedersächsischen Verden ihre Erfahrungen auf. Die Schicksale anderer Häftlinge ebenso wie ihre genaue Zahl bleiben bis heute unbekannt.
Am Samstag, 30. September, 14.30 Uhr, findet die Führung „Die sowjetische Geheimdienststadt ‚Militärstädtchen Nr. 7’“ statt. Tickets: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Treffpunkt: Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam, Leistikowstraße 1. Telefon: 0331/201 15 40, E-Mail: mail@leistikowstrasse-sbg.de, Tickets online unter: www.leistikowstrasse-sbg.de
Potsdamer Neueste Nachrichten am 21.08.2023
Eklat um Leistikowstraße: Verein wird Gedenken im ehemaligen Potsdamer KGB-Gefängnis verboten
Ehemalige Insassen wollten in der Gedenkstätte am 23. August den Opfern des stalinistischen Terrors gedenken. Warum das Anliegen zum Streit mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten führte.
Von Erik Wenk
An welchem Tag soll man den Opfern des stalinistischen Terrors gedenken – am 15. oder am 23. August? Diese Frage hat zum offenen Konflikt zwischen dem Verein „Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam“ und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten geführt, zu der seit diesem Jahr auch die Gedenkstätte Leistikowstraße in Potsdam gehört.
Seit 2016 hatte der Verein am 23. August, dem Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus, Gedenkveranstaltungen in der Leistikowstraße durchgeführt. In diesem Jahr sollen sie nicht stattfinden. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten verwehrt dem Verein, der sich maßgeblich um den Erhalt des ehemaligen KGB-Gefängnisses verdient gemacht hat, eine Gedenkveranstaltung in der Leistikowstraße am 23. August.
Der Gedenkstättenverein: „Wir sind entsetzt und bestürzt, dass der Gedenktag uns in der Gedenkstätte für die Zukunft verboten werden soll. Ein Verbot bietet sich nicht zur Lösung des Konfliktes an“, heißt es in einer öffentlichen Stellungnahme des Vereins. Selbst ein stilles Gedenken wollte die Stiftung zunächst nicht erlauben, entschied sich dann jedoch um. Der Verein darf am Mittwoch, dem 23. August, in Stille auf dem Hof des ehemaligen Gefängnisses gedenken. Die eigentliche Gedenkveranstaltung des Vereins wird um 18. 30 Uhr im Gärtnerhaus der Villa Lepsius stattfinden, dabei wird auch die lettische Botschafterin sprechen.
Die Gedenkstätte Leistikowstraße hatte stattdessen am 15. August eine offizielle Gedenkveranstaltung durchgeführt, die PNN berichteten. Das Datum wurde gewählt, weil am 15. August 1945 das Haus in der Leistikowstraße offiziell als Gefängnis in Betrieb genommen wurde. Zudem wurde das Gebäude am 15. August 1994 an die Stadt Potsdam zurückgegeben.
„Für alle Einrichtungen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gilt der Grundsatz, dass Gedenkveranstaltungen einen konkreten Ortsbezug haben sollen“, sagt Gedenkstätten-Leiterin Ines Reich auf Nachfrage der PNN. „Der 23. August als historisches Datum des sogenannten Hitler-Stalin-Pakts weist diesen konkreten Ortsbezug nicht auf.“
Die Gedenkstätte und das Kuratorium der Gedenkstätte hätten den Verein darum gebeten, von Gedenkveranstaltungen am 23. August in der Leistikowstraße „Abstand zu nehmen“, so Reich. Das Angebot, gemeinsam am 15. August das Gedenken zu begehen, war vom Verein abgelehnt worden.
Historiker kritisiert Stiftung
Aus Sicht des Vereins gibt es gute Gründe, am 23. August festzuhalten. Der Gedenktag wurde 2008 in der „Prager Erklärung“ vorgeschlagen, zu deren Unterzeichnern unter anderem Vaclav Havel und Joachim Gauck gehörten. 2009 wurde der Gedenktag mit großer Mehrheit des Europaparlaments beschlossen.
„Es ist der einzige überregionale Gedenktag, der an die Opfer des Stalinismus erinnert“, heißt es im Statement des Vereins. Das Datum bezieht sich auf den 23. August 1939, als der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion geschlossen wurde, in dem Hitler und Stalin Europa zwischen sich aufteilten.
Der antitotalitäre Konsens, an den der 23. August erinnert, hat sehr wohl etwas mit dem Haus in der Leistikowstraße zu tun.
Neuer Vorstand vom Gedenkstättenverein gewählt
Pressemitteilung: Auf der Mitgliederversammlung des „Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam e.V.“ wurde am 30. Oktober 2019 ein neuer Vorstand gewählt.
Zur ersten Vorsitzenden wurde Gisela Rüdiger gewählt, zum zweiten Vorsitzenden der bisherige zweite Vorsitzende Bernhard Kaltenbach, zur Schatzmeisterin Elisabeth Jansen, zur Schriftführerin Kerstin Walther. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden die Zeitzeugin Margot Bonk und der Historiker Dr. Richard Buchner gewählt.
Gisela Rüdiger ist seit der Gründung des Vereins im Jahr 2003 Mitglied des Vereins. Sie war von 1991 bis 2008 Leiterin der Außenstelle des Bundesbeauftragten der Stasi- Unterlagenbehörde in Potsdam. Sie übernimmt das Amt von dem bisherigen Vorsitzenden Dr. Richard Buchner.
Der Vorstand dankte Dr. Buchner für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit, seinem unermüdlichen und von Herzen kommenden Einsatz für die unschuldig Verfolgten des sowjetischen Terrorsystems. Er hat viele Zeitzeugengespräche und weitere Veranstaltungen durchgeführt. Sein umfangreiches fundiertes Wissen über die Stalinistische Schreckensherrschaft hat stets geholfen, die Verbrechen, die in dem ehemaligen sowjetischen Untersuchungsgefängnis in der Potsdamer Leistikowstraße verübt worden sind, besser zu verstehen.
_________________________________________________________________________________________________
Unschuldig zu Tode verurteilt
Vor 73 Jahren sind vier Schüler vom Sowjetischen Geheimdienst aus dem Potsdamer Einstein-Gymnasium geholt worden. Nur einer hat überlebt.
von Naima Wolfsperger in PNN am 18.04.2019
Potsdam – Vor 73 Jahren, am 18. April 1946, sind die Schüler Joachim Douglas, Klaus Tauer und Kurt Eylert erschossen worden. 1945 wurden sie und ihr Freund Hermann Schlüter vom Sowjetischen Geheimdienst aus ihren Klassen im Einstein-Gymnasium geholt. Margot Bonk, geborene Douglas, erinnerte sich zum Jahrestag in der Gedenkstätte Leistikowstraße an ihren Bruder. Seiner und seiner Freunde ist am Mittwoch in einem Zeitzeugengespräch gedacht worden.
Zehn Tage, nachdem er und seine Freunde aus der Klasse gezogen wurden, sei ihr Bruder Joachim wieder nach Hause gekommen, erzählt Bonk. Er und seine Freunde sind in einer Villa in der Geschwister-Scholl-Straße verhört worden – „man hat ihnen Werwolf-Tätigkeiten vorgeworfen“, erklärt die 79-Jährige.
Als Werwölfe galten nach dem Zweiten Weltkrieg Männer, die im Geiste des Nationalsozialismus Anschläge gegen die Alliierten verübten oder sich an „Verrätern“ des NS-Deutschlands rächten. Ein Vorwurf, der den Jungen nie nachgewiesen wurde. Trotzdem mussten die Schüler in den folgenden Monaten regelmäßig zu Verhören. Joachim Douglas letzter Termin war an Heiligabend 1945. „Joachim ging und kam nicht mehr zurück“, sagt Bonk.
Sie habe die Geschichte schon häufig erzählt, einfacher werde es nicht – auch nach so vielen Jahren nicht. Sie erinnere sich noch zu gut, an den Wachturm des Militärtribunals in der Villa Herzfeld an der Geschwister-Scholl-Straße, auf dem immer ein Wachmann zu sehen war. An ihren Vater, der dort immer wieder Kleidung und Essen für den einzigen Sohn abgab. Eines Tages habe man nichts mehr angenommen. „Der Joachim sei weg, hieß es dann. Und niemand sagte uns, wo er ist.“
Man hatte die vier Schüler in die Leistikowstraße gebracht und sie dort verhört und gefoltert. Schließlich wurden sie zum Tode verurteilt. Joachim Douglas, Kurt Eylert und Klaus Tauer waren damals 16 Jahre alt, Hermann Schlüter 15.
„Klar ist: Jedem, der von 1945 bis etwa 1953 in die Leistikowstraße kam, wurde von den Sowjets vorgeworfen, ein Nazi zu sein“, sagt Richard Buchner, Vorsitzender des Gedenkstättenvereins. Manche seien an den Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt gewesen, sagt er. „Viele waren aber unschuldig.“ Deshalb widmet er den Gedenktag den „unschuldigen Opfern“ der Besatzungsmacht.
Die vier Schüler hätten Gnadengesuch einreichen dürfen und das auch getan. „Mindestens 80 Prozent dieser Gesuche von Häftlingen aus der Leistikowstraße wurden abgelehnt“, sagt Buchner. Nur das Gnadengesuch des 15-jährigen Schlüter wird angenommen, er wird zu 20 Jahren Arbeitslager verurteilt. Er überlebt und stirbt 2018 im Alter von 88 Jahren.
Keine genauen Informationen:
Laut den Unterlagen aus der Besatzungszeit seien die anderen drei im Potsdamer Umland erschossen worden. Über die genauen Umstände und den Ort gibt es keine Informationen.
Bonk hat nach der Wende die Akten gegen ihren Bruder angefordert. Sie bekommt Verhörprotokolle. „Es gab keine Beweise gegen meinen Bruder, das geht daraus klar hervor“, sagt sie.
Ex-Häftling im KGB-Gefängnis Leistikowstraße. „Ich habe sofort nein gesagt“
Potsdamer Neueste Nachrichten, 27.03.15:
Ex-Häftling im KGB-Gefängnis Leistikowstraße.
„Ich habe sofort nein gesagt“
von Holger Catenhusen
Johannes Oesterhelt saß nach dem Zweiten Weltkrieg im Untersuchungsgefängnis in der Leistikowstraße, dann wurde er in die Sowjetunion gebracht. Der Zeitzeuge berichtet von seiner Haft, die 25 Jahre andauerte.
Nur ein paar Sekunden hat es gedauert: Man stellte ihm eine Frage, er gab eine Antwort. Dann war über sein Schicksal entschieden. „Ich habe 13 Jahre lang nicht in Freiheit gelebt“, sagt Johannes Oesterhelt. Am Mittwochabend war er als Zeitzeuge zu Gast in der Gedenkstätte Leistikowstraße. Hier an diesem Ort hatte die sowjetische Militärspionageabwehr nach dem Zweiten Weltkrieg ein Untersuchungsgefängnis eingerichtet, inmitten des von den Sowjets gegründeten „Militärstädtchens Nummer 7“. Von Mai bis Oktober 1948 hat auch Oesterhelt hier eingesessen. Am Ende erhielt der damals 23-Jährige vom sowjetischen Militärtribunal sein Urteil: 25 Jahre Haft wegen Spionage und unerlaubter Gruppenbildung.
“Sind Sie bereit, ein Zellenspitzel zu sein?”
Dabei hatte Oesterhelt in seiner Potsdamer Zelle zuvor schon einmal kurz die Freiheit gewinkt. Einige Zeit nachdem man ihn von Weimar aus, wo er zunächst inhaftiert war, in das Sowjetgefängnis am Neuen Garten überstellt hatte, wurde er – wieder einmal – zu seinen Vernehmern geführt. Doch dieses Mal war es anders als sonst. Man bot dem Häftling Oesterhelt plötzlich belegte Brote an und gab ihm zu rauchen. Und dann stellte einer der Männer jene Frage, die für den Gefangenen zur Schicksalsfrage werden sollte: Ob er bereit sei, ein Zellenspitzel zu werden, also mit den Vernehmern zusammenzuarbeiten und andere Häftlinge auszuspionieren. Dann, so gab man zumindest vor, würde man ihm in absehbarer Zeit die Freiheit schenken. „Ich habe sofort nein gesagt“, berichtete der mittlerweile 89-jährige Oesterhelt am Mittwoch. „Junger Mann, das werden Sie noch einmal ganz schwer bereuen“, habe einer der Vernehmer darauf zu ihm gesagt. Nach dem Gespräch ging es für den Häftling zurück in eine andere Zelle als zuvor: „Ich kam in den Keller runter, in die hinterste Ecke“, erinnerte sich Oesterhelt in dem vom Gedenkstättenverein organisierten Zeitzeugengespräch, zu dem rund 30 Zuhörer gekommen waren.
Doch warum war Oesterhelt, der später in der DDR als Simultanübersetzer für Russisch und Deutsch arbeitete, in die Fänge der Sowjets geraten? Ein Bekannter, der im Krieg gemeinsam mit ihm die Fliegerausbildung absolviert hatte – als ganz junger Mann war Oesterhelt Jagdflieger im Kriegseinsatz –, habe ihn eines Tages gefragt, ob er bereit sei, Kennzeichen von sowjetischen Militärfahrzeugen zu notieren. Das habe er dann auch hin und wieder gemacht. Ob ihm damals bewusst gewesen sei, welchen Auftraggeber der Bekannte hatte? „Im Prinzip ja“, sagt Oesterhelt heute. Es habe sich um die Organisation Gehlen, den Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, sowie um den britischen Geheimdienst gehandelt. Und bei eben jenem Bekannten aus Jagdfliegerzeiten sei eines Tages in Leipzig eine Razzia durchgeführt worden. Die Ermittler fanden einen Kalender. Darin 28 Namen von Menschen, mit denen der Mann Kontakt hatte. Unter ihnen der junge Johannes Oesterhelt. Alle wurden sie in das Potsdamer Sowjetgefängnis gebracht, berichtete der 89-Jährige, der heute in Radebeul lebt.
Von Potsdam im Viehwaggon in die Sowjetunion
Im Februar 1949 ging es für ihn und die Gruppe, darunter seine damalige Verlobte Ruth, mit der er später bis zu ihrem Tod vor anderthalb Jahren verheiratet war, von Potsdam aus über das ehemalige NS-Konzentrationslager Sachsenhausen per Viehwaggon in die Sowjetunion. Oesterhelt kam ebenso wie seine Verlobte in ein Lager im russischen Inta, einer südwestlich von Workuta gelegenen Ortschaft. Hier musste er im Kohlebergbau arbeiten. Einen großen Vorteil hatte die Arbeit in Tiefen von 200 bis 400 Metern, so Oesterhelt: Mindestens acht Grad plus hätten unter Tage geherrscht. Draußen war es im Winter hingegen eisig kalt. Temperaturen von 50 Grad minus und manchmal noch weniger hätte es dort zuweilen gegeben, erzählte Oesterhelt. Er habe im Lager übrigens immer ausreichend zu Essen gehabt. Nur eintönig sei die Nahrung gewesen. Als Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) 1955 die letzten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion heimholte, ging es auch für Oesterhelt und seine Verlobte zurück auf deutschen Boden. Sie landeten in der DDR. Seine Ruth kam frei, doch er wurde ins Gelbe Elend gesteckt, einem berüchtigten DDR-Gefängnis in Bautzen.
Die DDR-Wachleute seien im Gegensatz zu den Sowjets sehr unfreundlich gewesen. „Du wurdest plötzlich angeschnauzt“, berichtete der einstige Häftling. Von Bautzen aus kam Oesterhelt in das Gefängnis in Brandenburg/Havel. Erst am 28. November 1960 entließ man ihn schließlich. Eine Amnestie nach dem Tod von DDR-Präsident Wilhelm Pieck machte es möglich. Fünf Tage nach seiner Entlassung, am 3. Dezember 1960, heiratete er seine Ruth – 14 Jahre nach ihrer Verlobung.
PNN 28.03.2014
Gedenkstätte KGB-Gefängnis zieht positive Bilanz nach fünf Jahren.
Opfervertreter sind unzufrieden
Nauener Vorstadt - Vor fünf Jahren hat die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße erstmals seit der Sanierung die Türen geöffnet: Das Jubiläum soll am Wochenende mit Sonderführungen begangen werden, wie die Gedenkstätte mitteilte. Am Sonntag wird es von 11 bis 18 Uhr jeweils zur vollen Stunde kostenlose Führungen durch die Dauerausstellung in dem ehemaligen Untersuchungsgefängnis des sowjetischen Geheimdienstes KGB geben.
Gedenkstättenleiterin Ines Reich zieht eine positive Bilanz: 23 000 Besucher hätten das Haus im früheren „verbotenen Städtchen“, wie das vom KGB genutzte Gebiet am Neuen Garten im Volksmund hieß, besucht. Durch die Recherchen der Mitarbeiter sei es gelungen, viele bisher unbekannte frühere Häftlinge – sowohl deutsche als auch russische – ausfindig zu machen. „Dabei gab es von Anfang an eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Häftlingen“, sagte die Historikerin gegenüber den PNN. Das gespannte Verhältnis zu den kritischen Zeitzeugen und Opfervertretern vom Gedenkstättenverein und dem Verein Memorial – zur Eröffnung der Dauerausstellung hatte es eine Protestdemonstration von Opfervertretern gegeben – sei mittlerweile konstruktiv, sagte die Gedenkstättenleiterin und verweist auf die Veranstaltungen, die die Zeitzeugen im Haus durchführen.
Für Gisela Rüdiger vom Gedenkstättenverein ist das Ergebnis indes immer noch „inhaltlich enttäuschend“, wie sie auf PNN-Anfrage sagte. So habe sich an den Texttafeln, die von Zeitzeugen und Opfervertretern als verharmlosend kritisiert werden, nichts geändert. Auch Hinweise auf die Haftbedingungen seien nicht aufgenommen worden – so seien etwa die Kellerfenster in der Gedenkstätte nicht verdunkelt, so wie Zeitzeugen das einst erlebt hatten. „Es ist bis heute nicht gelungen, mit den Zeitzeugen zu einem Einvernehmen zu kommen“, kritisiert Rüdiger. Immerhin gebe es eine gemeinsame Jahresplanung, bei der auch Veranstaltungen der Zeitzeugeninitiative berücksichtigt werden. Allerdings dürften Zeitzeugenberichte nach wie vor nicht im Haus ausgelegt werden, Veranstaltungen der Zeitzeugen, wie etwa erst an diesem Mittwoch, würden zudem nicht auf der Internetseite der Gedenkstätte angekündigt.
Gedenkstättenleiterin Reich wies die Kritik an der Ausstellung gegenüber den PNN zurück: Die Dauerausstellung sei vom Fachpublikum sehr positiv aufgenommen worden, sagte sie. Man pflege auch einen guten Kontakt zu neu ausfindig gemachten Häftlingen.
In diesem Jahr ist unter anderem im Mai eine Themenwoche anlässlich des 20. Jahrestages des Abzugs der sowjetischen Truppen geplant, kündigte Reich an. Zudem sollen die Häftlingstransporte nach Torgau aus der ersten Zeit des Gefängnisses Ende der 1940er-Jahre wissenschaftlich aufgebarbeitet werden. So soll das Häftlingsbuch ergänzt werden. jaha
22.05.2013 Märkische Allgemeine
Die Wattejacke als Lebensretter
1953 entging Peter Seele beim Häftlingsaufstand in Workuta nur knapp dem Tode / Themenwoche im einstigen KGB-Gefängnis
Die Schapka als Symbol...
Potsdam - Er lag im Graben, in den das Blut seiner Kameraden floss. Mit dem Kopf auf den Knien hörte er die Schüsse. Dann – zisch! – sauste eins der explosiven Geschosse direkt über seinen Rücken hinweg. „Zum Glück hatte ich die Wattejacke an“, sagt Peter Seele und schüttelt den Kopf. Der 84-jährige Potsdamer kann auch nach all den Jahren kaum fassen, was er damals, am 1. August 1953, beim Häftlingsaufstand im russischen Straflager in Workuta erlebt hat.
Im ehemaligen KGB-Gefängnis – heute Gedenk- und Begegnungsstätte – in der Leistikowstraße 1 wird ab Dienstag bei einer Themenwoche dem 60. Jahrestag des Aufstandes gedacht, bei dem etwa 60 Männer starben und mehr als 100 schwer verletzt wurden. Viele ehemalige Potsdamer Häftlinge mussten auch im Arbeitslager in Workuta schuften. „Mit dem Thema wollen wir an die Schicksale der betroffenen Menschen erinnern, aber auch an ihren Überlebenswillen und ihren Widerstandsgeist“, sagt Gedenkstättenleiterin Ines Reich. So wird es in der kommenden Woche Vorträge, Filmvorführungen und Zeitzeugengespräche geben. Die eigentliche Ausstellung wird am Freitag im Beisein von Peter Seele eröffnet (zum Programm: siehe Infokasten).
Seele war 1952 von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und mehrere Monate im Untersuchungsgefängnis in der Leistikowstraße inhaftiert worden. Er sollte russischer Spion werden – doch er wollte nicht. In einer Kiesgrube in Bornstedt bekam der damals 23-Jährige buchstäblich die Pistole auf die Brust gesetzt. Mit viel Glück überlebte er – um später in Workuta wieder nur knapp dem Tode zu entkommen. „Ohne die Wattejacke wär’s vorbei gewesen“, sagt er. Eine dieser Jacken, mit der sich die Häftlinge im Straflager vor der klirrenden Kälte schützten, ist Teil der Ausstellung in der Gedenkstätte. „Wir wollten die Tafelausstellung zum Aufstand mit dreidimensionalen Objekten ergänzen“, sagt Ines Reich.
So können Besucher auch die Schapka – eine Mütze aus Polarfuchsfell – von Peter Seele in der Ausstellung sehen. „Die ist mein Heiligtum“, sagt der ehemalige Kraftfahrer und streicht über das weiche rote Fell. Gekauft hat Peter Seele die Mütze auf seiner Heimfahrt aus Workuta mit dem Geld, das er im Straflager verdient hat. „50 Rubel hatte ich“, erinnert er sich. Am Bahnhof kaufte er sich neben der Mütze einen ganzen Korb voll Eier und einen bestickten Kosakenmantel, der ihm den Spitznamen „Rasputin“ einbrachte. Zu Hause in Babelsberg erkannte ihn seine Patentante in dem Aufzug zunächst gar nicht wieder. Die Schapka ist für Peter Seele ein Symbol seiner Heimkehr. „Die würde ich nie hergeben“, sagt er.
Neben Mütze und Jacke sind in der Ausstellung auch ein Koffer und ein besticktes Säckchen zu sehen – Symbol für Rückkehr und die Arbeit der Frauen im Lager, die viel Zeit mit Sticken verbrachten. Neben dem Männerlager gab es in Workuta auch drei Frauenlager, in denen 1953 allerdings nicht gestreikt wurde. „Für die Häftlinge war der Streik eine Art Katalysator für die Entlassung“, sagt Ines Reich. Peter Seele jedoch musste noch zweieinhalb Jahre warten, bis er in die Potsdamer Heimat zurückkehren konnte. (Von Meike Jänike)
22.05.2013 Landeszentrale für politische Bildung - Weiterhin heftige Kontroverse um die Leistikowstraße
Stellungnahme:
24.05.2013 Potsdamer Neueste Nachrichten
Stalinismus-Opfer nutzen Buch-Diskussion mit dem Historiker Wolfgang Benz zur Gedenkstätten-Kritik
von Guido Berg
Innenstadt - Zu einer emotionalen Kontroverse vor überfülltem Auditorium kam es am Mittwochabend in der Potsdamer Landeszentrale für politische Bildung. Vorgestellt wurde das vom Historiker Wolfgang Benz herausgegebene Buch mit dem langen Titel „Ein Kampf um Deutungshoheit. Politik, Opferinteressen und historische Forschung. Die Auseinandersetzung um die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstrasse Potsdam“.
Verbände von Opfern stalinistischer Verfolgung hatten schon im Vorfeld ihren Unmut über das Buch geäußert; Mitglieder des Vereins Gedenk- und Begegnungsstätte Ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam e. V. verteilten vor Beginn eine kritische Stellungnahme. Es würden „fehlerhafte, diskriminierende oder polemische Aussagen über uns gemacht“. Eine Tätlichkeit des Zeitzeugen Lothar Scholz gegen die Gedenkstättenleiterin Ines Reich im März 2012, die am 30. Mai vor dem Potsdamer Amtsgericht verhandelt wird, mag Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale, zu der ironischen Auftaktbemerkung veranlasst haben: „Die Messer habe ich heute nicht eingesammelt. Ich hoffe, die Waffen bleiben in den Taschen.“
Die Hoffnung erfüllte sich, geschenkt wurde sich in der von Alfred Eichhorn moderierten Podiumsdiskussion aber nichts. Die Diskutanten – Ines Reich, Wolfgang Benz, Horst Schüler, Ehrenvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (OUKG), und Anna Kaminsky, Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – setzten eingangs noch auf Gemeinsames. Eichhorn, letzter Chefredakteur von Radio DDR und freier Journalist, machte mit einem Benz zugeschriebenen Zitat zunächst den Grundkonflikt klar: „Historiker und Zeitzeugen sind natürliche Feinde.“ Der Antisemitismusforscher winkte ab: „Einen größeren Blödsinn habe ich nie gehört“, so Benz. Ohne Empathie mit den Opfern könne man eine Chronik machen, aber keine Geschichtsschreibung. Nachdem Horst Schüler antwortete, kam kurz gar so etwas wie Harmonie auf. Der Ex-Häftling im russichen Gulag Workuta: „Wir wissen, unsere Erfahrungen sind von Emotionen geprägt.“ Zeitzeugen und Historiker müssten „in gegenseitigem Respekt aufeinander zugehen“. Auch die Benz-Kritik an der Totalitarismus-Theorie, der Vergleich von Faschismus und Stalinismus, als „Konstruktion eines allgemeinen Bösen“ und „Ende der Differenzierung“ stand nicht im Gegensatz zu Schülers Position: „Wir werden den Holocaust immer anerkennen als das schlimmste Verbrechen der Menschheit.“
Doch spätestens, als es konkret um Textpassagen im Buch und insbesondere aber in der Gedenkstätten-Ausstellung ging, traten die Gegensätze scharf hervor. Anna Kaminsky kritisierte, dass die Geschichte des Hauses Leistikowstraße 1 sowie des Eigentümers, des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsverein, nicht später erforscht wurde. Stattdessen fehle in der Ausstellung, „wie Spionage instrumentalisiert wurde, um Bürger mundtot zu machen“. „Es ging um die Durchsetzung einer neuen Diktatur in der SBZ, das wäre die Grundlage gewesen!“ In diesem Zusammenhang machte Ines Reich die Bemerkung: „Die politischen Rahmenbedingungen sind, wie sie sind: Wir haben eine rot-rote Landesregierung.“ Diese Dinge müsse „man auch immer mitdenken“.
Wohl auch, weil es Herausgeber Benz gelang, sein Buch aus der Schusslinie zu nehmen – „Sie können ihm eines oder viele andere Bücher entgegensetzen“ – wurde immer mehr Ines Reich Adressat von Kritik: Ihr wurde vorgeworfen, keine Führungen in der Leistikowstraße durch Zeitzeugen zuzulassen und in den Ausstellungstexten Distanz zu wahren – „als gucke da jemand vom Mond auf die Erde“. Stein des Anstoßes ist etwa die Passage „manche überlebten die Haft nicht“, was von Opfern als „unverhältnismäßig hart“ angesehen wird. Nie sei so über Opfer vor 1945 geschrieben worden. Historiker Benz versuchte beizuspringen: Nie würde man von ihm hören, dass Opfer vor 1945 Priorität hätten „und ich habe auch bei Frau Dr. Reich keine solche Haltung bemerken können“. Kaum mehr entgegnen wollte Benz auf eine flammende Rede des Regisseurs Dirk Jungnickel: Ines Reich habe auf eine „biologische Lösung“ gesetzt, die von ihr ausgegrenzten Zeitzeugen seien tot oder entmutigt. Sie habe „in Gutsherrinnenart agiert“ und „den Gulag vergessen – das ist unverzeihlich“. Die ersten, noch nicht vom Beirat korrigierten Texte seien „eine Katastrophe gewesen“, ihr fehle neben der menschlichen „die wissenschaftliche Kompetenz“. Auch Brandenburgs Kulturstaatssekretär Martin Gorholt (SPD) – „er hätte eine moderierende Rolle spielen müssen“ – und Ingeborg Berggreen-Merkel, Abteilungsleiterin beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – „getan hat die Frau nichts“ – bekamen ihr Fett weg. Ines Reich entgegnete, dies sei „Häme, die mich betroffen macht“; sie glaube, hier liege „eine Feindprojektion“ vor.
Trauer um DDR-Bürgerrechtler
Bob Bahra ist tot
Die Stadt hat einen beherzten und entschiedenen Bürger verloren.
Potsdam - Der Grafiker und DDR-Bürgerrechtler ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Er hatte sich in den vergangenen Jahren engagiert für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts eingesetzt.
Trauer um Bob Bahra: Der Potsdamer Grafiker und DDR-Bürgerrecht-ler ist am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Bürgermeister Burkhard Exner reagierte mit Bestürzung und Trauer auf die Nachricht: "Die Landeshauptstadt Potsdam hat einen beherzten und entschiedenen Bürger verloren."
In den vergangenen Jahren hat Bahra bei der Aufarbeitung von DDR-Unrecht mitgewirkt. Mit seinen oft herausfordernden Worten stieß er die Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam zum Nachdenken und Handeln an. Zu seinen Ehren werde in der Gedenkstätte Lindenstraße für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert sowie auf der Internetseite www.foerder-gemeinschaft-lindenstrasse.de ein Kondolenzbuch ausliegen, so Exner. "
Bob Bahra war eine wichtige Stütze bei der Arbeit der Gedenkstätte Lindenstraße, als Zeitzeuge verdeutlichte er die Ausmaße und Absurdität des Verfolgungssystems in der DDR immer wieder anhand seiner Stasi-Akte", sagte Burkhard Exner und lobte Bahras Eintreten für Gerechtigkeit und gegen Verklärung von DDR-Biografien und Geschichte.
Bahra wurde 1968 wegen seines Protestes gegen die militärische Unterdrückung des Prager Frühlings zu einer Haftstrafe verurteilt, die er in der Potsdamer Untersuchungshaftanstalt des Staatssicherheitsdienstes in der Lindenstraße und im Gefängnis Cottbus verbüßte. Denunziation durch Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit aus dem direkten Lebens- und Arbeitsumfeld Bahras hatten zur Verhaftung geführt. Später war Bahra Aktivist der Umweltgruppe ARGUS, gestaltete Umweltblätter und das Plakat zum 1. Potsdamer Pfingstbergfest.
Seit 2009 war er der Organisator des Potsdamer MauerVerLaufs, den er gemeinsam mit der Fördergemeinschaft "Lindenstraße 54" ins Leben gerufen hatte. Er setzte sich mit dem Verein Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte in Brandenburg außerdem erfolgreich dafür ein, die einzig erhaltenen Mauersegmente in der Stubenrauchstraße unter Denkmalschutz zu stellen. (PNN)
20.08.2012 Potsdamer Neueste Nachrichten
Leistikowstraße: Reich zum Rücktritt aufgefordert Kritiker drängen auf Zeitplan zur Überarbeitung der Dauerausstellung im ehemaligen KGB-Gefängnis
von Jana Haase
Nauener Vorstadt - Verhärtete Fronten beim Streit um die Gedenkstätte KGB-Gefängnis in der Leistikowstraße: Eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde mit Kritikern und Verantwortlichen für die im April eröffnete Dauerausstellung blieb am Freitagabend ohne Ergebnis. Eingeladen hatte der Gedenkstättenverein, die Moderation übernahm Julius H. Schoeps, Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums an der Uni Potsdam. Wie hoch die Erwartungen waren, zeigte der Besucherandrang: Mit mehr als 70 Zuhörern war der Foyer-Raum voll.
Die Fronten blieben verhärtet. Die Kritiker – vertreten durch Hubertus Knabe, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen sowie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Leistikowstraße, die FDP-Landtagsabgeordnete Linda Teuteberg und die DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld (CDU) – forderten einen Fahrplan für die in ihren Augen dringend nötige grundlegende Überarbeitung der Ausstellung. Dagegen halten Gedenkstättenleiterin Ines Reich und Brandenburgs Kulturstaatssekretär Martin Gorholt als Vorsitzender des Kuratoriums der Gedenkstätte eine solche Überarbeitung weiterhin für nicht notwendig. Mit dieser Haltung sorgten sie am Freitag bei Opfervertretern für Empörung und Unverständnis. Knabe warf Reich vor, sich der Zusammenarbeit mit Zeitzeugen und Ehrenamtlern zu verschließen. Zugleich stellte er ihre Kompetenz als Leiterin in Frage. Der Leiter einer Gedenkstätte müsse zuhören und integrieren können, sagte Knabe: „Er muss den Zeitzeugen das Gefühl geben, das ist ihr Haus. Wenn ein Leiter das nicht kann, dann ist er an der falschen Stelle.“ Auf die indirekte Rücktrittsforderung reagierte Reich nicht.
Dass es eine ganze Reihe von Potsdamern gibt, die die Dauerausstellung nicht als „ihr Haus“ begreifen, war spätestens bei der Eröffnung im April deutlich geworden: Mit einer Menschenkette protestierten die Gegner, unter anderem weil sie die Leiden der früheren Häftlinge in der Schau nicht ausreichend gewürdigt sehen. Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) waren den Kritikern mit einem Gesprächsangebot entgegengekommen.
Getan hat sich seitdem aber offenbar nichts. Dabei wiegen die Vorwürfe gegen die unter Ines Reich entwickelte Dauerausstellung schwer: Von einer Verharmlosung von Terror und der Gewalt im Namen kommunistischer Regime spricht Hubertus Knabe. Vera Lengsfeld wirft der Schau Geschichtsfälschung vor. Und Linda Teuteberg vermisst den Mut, „Unrecht als Unrecht zu benennen“ und ein klares Bekenntnis zu den Werten der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das machen die Kritiker etwa an den Ausstellungstexten fest. Die seien einerseits zu kompliziert – Knabe führte als Beispiele die unkommentierte Verwendung von Begriffen wie „Repatriant“ und „Tschekist“ an. Noch schwerer der zweite Vorwurf: Mit den gewählten Formulierungen würden „die Dinge verräterisch verharmlost“. Ein Beispiel hierfür: Der Satz „Gewalt war ihnen nicht fremd“ über die sowjetische Geheimpolizei Tscheka. „Die Tschekisten haben Menschen tyrannisiert, um die kommunistische Diktatur durchzusetzen“, stellt Knabe klar. Die Kritiker bemängeln zudem fehlende Informationen zum sowjetischen Gulag-System und zum Widerstand in der SBZ/ DDR, einen zu starken Schwerpunkt auf die Täter und den fehlenden Charakter als Begegnungsstätte.
Gedenkstättenleiterin Reich wehrte sich gegen die Vorwürfe: Wegen fehlender Gelder werde die Ausstellung erst in einer zweiten Projektphase um die Themen Widerstand und Gulag-System erweitert. Ein Programm mit Führungen von Zeitzeugen gebe es bereits – dabei ist laut Programmflyer bis Jahresende keine solche Führung mehr vorgesehen. Martin Gorholt verteidigte die Ausstellung als „sehr gut“ und warf den Kritikern Polemik vor. Auch wenn die Ausstellung in Einzelpunkten geändert werden solle, müsse es nun besonders um die Erarbeitung eines Konzepts für die Arbeit mit Schülern gehen. Einen Konsens im Gedenkstättenstreit halte er derzeit nicht für möglich. Das sahen nicht nur die Kritiker, sondern auch Moderator Schoeps anders: „Es ist wichtig, dass eine solche Debatte geführt wird.“
20.08.2012 Märkische Allgemeine
Korrekturen in der Leistikowstraße
Ausstellung im ehemaligen KGB-Gefängnis soll überarbeitet werden – allerdings nicht grundlegend
Von Nadine Fabian
Die umstrittene Ausstellung im einstigen KGB-Gefängnis in der Leistikowstraße wird überarbeitet. Das teilte Staatssekretär Martin Gorholt (SPD) bei einer Podiumsdiskussion am Freitagabend mit. „Es geht aber nicht um eine grundlegende Überarbeitung“, sagte Gorholt. „Diese lehnen wir als Kuratorium ab und halten sie nicht für nötig.“
Zu der Aussprache hatten die Vereine „Gedenk- und Begegnungsstätte ehemaliges KGB-Gefängnis Potsdam“ und „Memorial Deutschland“ geladen. Noch bevor in der Gedenkstätte im April die Dauerausstellung eröffnet wurde, hatten Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen das Konzept als unseriös und einseitig kritisiert. Zeitzeugen beklagen, dass sie in die Arbeit der Gedenkstätte nicht genügend einbezogen werden und dass an das Leid der Opfer nicht angemessen erinnert werde. Der Streit zwischen Opfern stalinistischer Gewalt und der Gedenkstättenleitung hält seither an.
Die geplanten Korrekturen scheinen zumindest ein kleiner Schritt in Richtung Annäherung zu sein. Wie fern aber eine Einigung ist, zeigte das von Julius Schoeps moderierte Gespräch. Der Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums betonte, dass Streit stets befruchte: „Es ist viel schlimmer, wenn überhaupt nicht geredet wird.“ An der Debatte nahmen neben Gorholt, der Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Hubertus Knabe, die DDR-Oppositionelle Vera Lengsfeld, die FDP-Landtagsabgeordnete Linda Teuteberg und die Leiterin der Gedenkstätte Ines Reich teil. Auch wenn die Debatte ruhig und sachlich verlief – Reich wurde erneut harsch angegriffen. Kritik hagelte es sowohl aus dem Podium als auch aus den Zuhörerreihen. So warf ihr Dirk Jungnickel, zweiter Vorsitzender der Gedenkstätten-kritischen Zeitzeugeninitiative, wissenschaftliches Versagen vor. Die Ausstellung sei weichgespült, politische Aufklärung finde nicht statt. Der Ort sei zudem kühl und unemotional: „Dies ist für mich keine Gedenkstätte.“
Auch Knabe ging mit Reich hart ins Gericht. „Ein Leiter eines solchen Hauses muss zuhören, das Wesentliche aufnehmen und integrieren können. Wenn ein Leiter das nicht kann, dann ist er an der falschen Stelle.“ Er forderte, die Ausstellung grundlegend zu überarbeiten. So finde sich im gesamten Haus kein einziges Mal das Wort Kommunismus. Zudem sei die Sprache kompliziert und mit Worten gespickt, die nur wenige – sicher keine Jugendlichen – verstünden. „Diese Sprache ist verräterisch.“ Sie diene dazu, zu neutralisieren und zu verharmlosen. Die Dinge seien jedoch zu benennen, wie sie waren: „Hier sind Menschen tyrannisiert worden, um eine Diktatur durchzusetzen: und zwar eine kommunistische.“
Vera Lengsfeld warf der Gedenkstätte gar Geschichtsfälschung vor. Linda Teuteberg meinte indes, dass die Schau ihren Zweck, an das Leid zu erinnern und die Besucher zu informieren, „voll umfänglich“ erfülle. Dennoch halte sie Ergänzungen für sinnvoll. Ines Reich konterte die Kritik. Sie freue sich über die Runde: „Viele Augen, die auf einen Ort schauen, machen das Bild bunter.“
Gorholt überraschte seine Mitredner mit dem Bekenntnis, dass er und das Kuratorium die Ausstellung „inzwischen für eine sehr gute“ halten. Zum einen hätten ihm ehemalige Häftlinge gesagt, dass sie sich darin gut wiederfinden. Zum anderen würde sie umfassend informieren. Dennoch sei mit dem Ministerium vereinbart, dass „Dinge geändert“ werden. So seien Informationen über das Gulag-System und Widerstandsgruppen zu ergänzen.
Reich erklärte, dass tatsächlich drei wichtige – aber fest geplante – Elemente fehlen: die geforderte Gulag-Dokumentation, ein Modell von Haus und Umkreis sowie ein Buch mit den Namen der identifizierten Häftlinge. Bisher war laut Reich dafür kein Geld da.
April 2012: Nur ein Kollateralschaden?
Interview der Redaktion "Stacheldraht" mit Bodo Platt, Sprecher der Zeitzeugeninitiative Ehemaliges KGB-Gefängnis Leistikowstraße (Ausg. 04.2012)
Bodo Platt: 1930 in Görlitz geboren, dort im Mai 1948 verhaftet und verlegt in das Gefängnis Potsdam-Leistikowstraße; wegen angeblicher Spionage und Zugehörigkeit zu einer faschistischen Organisation zu 20 Jahren Arbeitslager verurteilt; November 1948 bis November 1949 Lager Sachsenhausen, dann Deportation nach lnta/Sowjetunion, Arbeit im Kohlebergbau, 1956 Entlassung; bis zur Pensionierung Realschuldirektor in der Bundesrepublik; verfasste über die Zeit seiner Gefangenschaft die Erinnerungsschrift „ Sobirai weschtschi! — Pack deine Sachen! “; seit 2005 Zeitzeugenarbeit
Stacheldraht: Die Zeitzeugeninitiative kritisiert das Ergebnis der dreijährigen Umgestaltung der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße, die am 18. April in Potsdam neu eröffnet wurde. Haben Sie Ihre Einwände bereits während der Erarbeitung vorgebracht?
Platt: Ich wurde für die Zeitzeugen in den Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten berufen. Dort habe ich die ganze Entwicklung miterlebt, vor allem die Erstellung der Ausstellungstexte durch die Leiterin, Frau Dr. Reich. Der Einspruch von Beiratsmitgliedern, auch von mir, hat zu insgesamt vier Textfassungen geführt. Aber wenn heute behauptet wird, es hätte mit den Zeitzeugen eine einvernehmliche Zusammenarbeit gegeben, ist das einfach unrichtig. Während des lnterimsbetriebes durften nicht einmal mehr die Erinnerungsberichte von Zeitzeugen und die Dokumentation „Von Potsdam nach Workuta“ ausliegen. Wir haben so gut wie nichts ausrichten können.
Stacheldraht: Was ist Ihrer Meinung nach in der Ausstellung falsch oder falsch gewichtet?
Platt: Es ergibt sich der Eindruck, dass die Texte aus einer historischen Sicht geschrieben wurden, die eher marxistischer Geschichtsauffassung entspricht. Es ist eine Auswahl, auch an Dokumenten, die den KGB als ganz normale Spionageabwehr der sowjetischen Armee erscheinen lässt. Immer im Kontext der Verdienste dieser Armee beim Kampf gegen den Nationalsozialismus. So erscheint, was später in der SBZ passiert ist, die Massenverhaftungen und auch die Geschehnisse im Potsdamer KGB-Gefängnis, lediglich als Kollateralschaden. Der KGB als politische Geheimpolizei wird kaum dargestellt.
Stacheldraht: Ist Ihres Erachtens nur die Darstellung falsch oder fehlen auch Themen?
Platt: Das hängt beides zusammen. Die Häftlingsschicksale und die schlimmen Zustände im Gefängnis sind nicht deutlich herausgearbeitet, der Jugendwiderstand damals und das Thema GULag sind völlig ausgeklammert.
Stacheldraht: Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeit von Besuchern der Ausstellung, sich mit der Materie auseinanderzusetzen?
Platt: Ich denke nicht. Frau Dr. Reich hat nach unseren Interventionen ja durchaus, vor allem in den sogenannten begleitenden historischen Texten, Änderungen zum Positiven vorgenommen. Aber das alles ist so umfangreich, so überfrachtet. Da werden sich zum Beispiel jugendliche Besucher kaum zurechtfinden. Sie werden eher irritiert das Haus verlassen und sich fragen, was damals eigentlich geschehen ist. Waren das alles zu Recht verurteilte Spione oder sind es unschuldige Menschen gewesen, die unter barbarischen Verhältnissen zu irrsinnigen Strafen verurteilt und nach Russland transportiert wurden?
Stacheldraht: Wie beurteilen Sie die Präsentation des Gebäudes nach der Fertigstellung?
Platt: Auch das sehe ich kritisch. Man hat die Kellerfenster aufgebrochen, so dass die Dunkelzellen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Wirkung wahrgenommen werden können. Einzelne Zellen sind völlig geschlossen, und vor allem ein ganz wichtiger Kellertrakt, die eine Seite des Kellers, auf der sich die schlimmsten Zellen dieses KGB-Gefängnisses zu unserer Zeit befanden, ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Als Argument wird genannt, dass ein zweiter Fluchtweg fehle, und die schlechte Stabilität des Hauses einen Durchbruch nicht erlaube. Das ist einfach nicht überzeugend, es hätte sicher eine Möglichkeit gegeben.
Stacheldraht: Bei der Eröffnung am 18. April gab es für die Kritiker Signale aus der Politik, die Anlass zur Hoffnung geben.
Platt: Uns hat sehr positiv berührt, wie Ministerpräsident Platzeck und auch Kulturstaatsminister Neumann zum Ausdruck gebracht haben, dass die Erfahrungen der Zeitzeugen stärker eingebracht werden müssten. Man könne diese Menschen nicht außen vor lassen. Beide waren auch bei unserer Pressekonferenz in der Villa Quandt zugegen. Dafür waren wir sehr dankbar. Ende Juni soll nun noch einmal eine gemeinsame Begehung im KGB-Gefängnis stattfinden, wo wir unsere Kritik dann auch erläutern werden.
Stacheldraht: Frau Dr. Reich hat sich Medien gegenüber geäußert, ihr Ziel sei ein modernes zeithistorisches Museum gewesen, andere hätten eher ein Mahnmal gewünscht Lehnen die Zeitzeugen wirklich eine wissenschaftliche Forschung ab?
Platt: Überhaupt nicht. Wir haben nichts gegen die Erforschung dieser Zeit. Nur fordern wir entschieden, dass die Verbrechen des KGB in der SBZ und später in der DDR, seine Menschenrechtsverletzungen und Pogrome in der Sowjetunion seit Bestehen der Tscheka nicht beschönigt und in diesem Kontext die Massenverhaftungen in der SBZ, die zehn Speziallager mit Zehn-tausenden willkürlich Verhafteter und Opfer nichtverschwiegen werden. Die Texte der Ausstellung geben z.B. die brutalen Verhörmethoden nicht wieder, sondern in mitunter fast idyllischen Szenen werden die Untersuchungsrichter als verständnisvolle Biedermänner dargestellt. Solche Texte haben mit der damaligen Realität überhaupt nichts zu tun. Das ist bewusste Täuschung und Verharmlosung. Wir wollen eine Gedenkstätte und kein den KGB verherrlichendes Museum. Eigentlich hatte ich diese acht Jahre meiner Gefangenschaft in mein Leben gut integriert und manches aus der Zeit sogar als wichtige Erfahrung nutzen können, z.B. das Kennenlernen der russischen Sprache und die Begegnung mit der klassischen russischen Literatur. Aber wenn man sich ständig mit Versuchen auseinandersetzen muss, die Vergangenheit zu verharmlosen, dann fordert das meinen Widerstand und Protest heraus.
Stacheldraht: Vielen Dank, Herr Platt.
21.04.2012 Evangelischer Pressedienst
Gedenkstätte im Potsdamer KGB-Gefängnis eröffnet
Platzeck und Neumann erinnern an Leid von Häftlingen - Opferverbände protestieren mit Menschenkette
Der große befürchtete Eklat blieb aus. Kein einziger Buhruf störte am Mittwoch in Potsdam die Eröffnung der Gedenkstätte am Ort des ehemaligen KGB-Gefängnisses. Und doch war der Konflikt mit zwei Opferverbänden allgegenwärtig, als Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) das kleine Haus in der Leistikowstraße der Öffentlichkeit übergaben.
Der stalinistische Terror habe es zu einem "Ort von Unrecht, Willkür, Gewalt und unvorstellbaren Leid" gemacht, betonte Platzeck in seiner Ansprache vor einer gemeinsamen Kranzniederlegung. In dem ehemaligen evangelischen Pfarrhaus nahe des Schloss Cecilienhofs hatte der sowjetische Geheimdienst zwischen 1945 und 1994 eine unbekannte Anzahl von Menschen inhaftiert.
Die neue rund 1.000 Quadratmeter große Dauerausstellung umfasst rund 400 Fotos, Dokumente und Medienstationen. Dabei werden insgesamt 50 Häftlingsschicksale exemplarisch dargestellt. Für die Realisierung stellten Bund und Land knapp 800.000 Euro zur Verfügung.
Nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus Ostdeutschland 1994 nutzten zunächst ein Gedenkstättenverein sowie eine Zeitzeugeninitiative das Haus als Veranstaltungsort. Erst dadurch rückte die Geschichte des 1916 erbauten Hauses inmitten eines früher hermetisch abgeschlossenen Militärareals in das Bewusstsein.
Sowohl Platzeck wie auch Neumann würdigten daher unter lautem Beifall der 400 eingeladenen Gäste die Verdienste dieser beiden Initiativen. "Es ist immer klug, Opfer und Zeitzeugen in die Gestaltung einer Gedenkstätte einzubeziehen", sagte der Kulturstaatsminister.
Mit Gründung einer eigenen Stiftung innerhalb der landeseigenen Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten begannen dann Ende 2008 die Vorbereitungen zunächst für eine vorläufige und dann für die endgültige Dauerausstellung, wie sie ab Donnerstag zu sehen ist. Gedenkstättenverein und Zeitzeugen-Initiative werfen der Stiftung nun vor, die Dramatik der Häftlingsschicksale zu wenig in den Vordergrund zu stellen und aus dem Haus ein "KGB-Museum" gemacht zu haben. Vor vier Wochen kam es sogar zu einem tätlichen Angriff eines ehemaligen Häftlings auf die heutige Gedenkstättenleiterin Ines Reich.
"Offensichtlich gehen die Erwartungen auseinander", resümierte Reich den Streit am Rande der Eröffnung. "Wir wollten ein modernes zeithistorisches Museum, andere eher ein Mahnmal." Reich bekräftigte ihr Angebot einer weiteren Zusammenarbeit. Für die Zeitzeugen-Initiative erklärte hingegen bei einer Pressekonferenz in der nahegelegenen Villa Quandt der ehemalige Häftling Bodo Platt: "Ziel war, uns auszugrenzen." In der Dauerausstellung fehle "der Mensch".
Der sichtlich in dem Streit um Vermittlung bemühte Ministerpräsident warb daher in seiner Ansprache dafür, gemeinsam Chancen für Verbesserungen der Dokumentation auszuloten und umzusetzen: "Wo sich etwas verbessern lässt, sollten wir das tun", sagte Platzeck.
Inwieweit Gedenkstättenverein und Zeitzeugen-Initiative die ehemaligen Häftlinge repräsentieren, ist unklar. An einer Menschenkette "zum Gedenken an die Opfer kommunistischer Gewalt" mit rund 50 Menschen nahmen am Mittag nur einige wenige von ihnen teil. Beide Verbände fordern mittlerweile die Abberufung Reichs. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten verwies ihrerseits darauf, dass sie mit einer Vielzahl von Opfern in Kontakt stehe.
epd ost jh bue